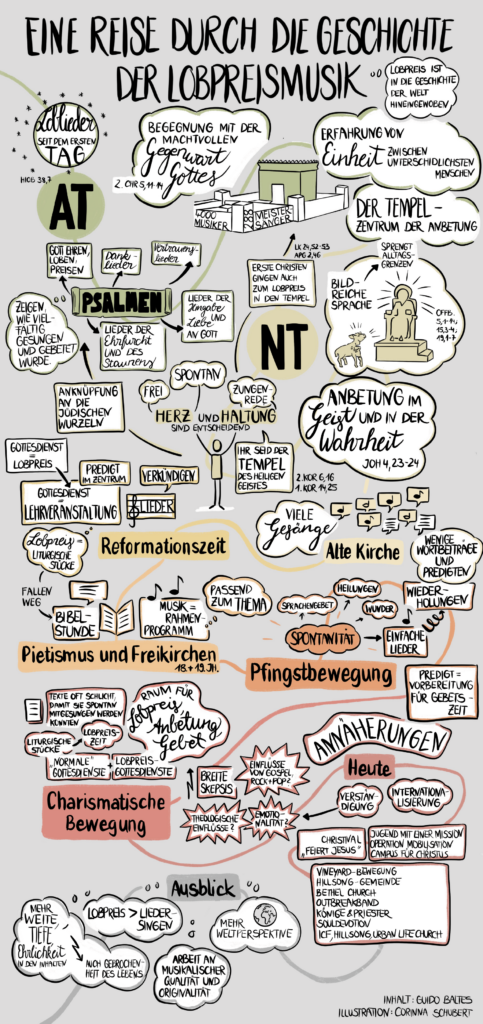
Neben den bekannten, vertrauten und lieb gewordenen Kanälen Orgel, Gesangbuch-Chorälen, Taizé, Chor- und Bläsermusik drängen die Lobpreismusik und Anbetungsbewegung mit Nachdruck ins Konzert der etablierten Player und wollen auch „mitspielen“. Von manchen eher belächelt, von anderen heiß geliebt, von wieder anderen kritisch bis ablehnend beäugt – ein Dazwischen scheint es oftmals kaum zu geben. Wie ist sie theologisch, musikalisch und besonders auch ekklesiologisch einzuordnen?
„Lobpreis, Worship, Anbetung“ wirken wie Modebegriffe der kirchlichen Popmusik. Und zugleich sind es große und sehr ehrwürdige Worte, die viele Fragen mit sich bringen: Ist Anbetung eine Lebenshaltung? Ist „Worship“ ein Musikstil? Ist Anbetung die Begegnung mit dem lebendigen Gott? Ist Worship die „cash-cow“ christlicher Verlage? – Und „Lobpreis“, was ist das? Ein kleines Zeitfenster im Gottesdienst? Braucht man da immer einen Beamer? Ist das, was der Posaunenchor macht, kein „Lobpreis”? Dass wir mit diesen Begriffen durchaus Unterschiedliches assoziieren und manche Missverständnisse dann auch zu unnötigen Abgrenzungen führen können, merken wir in Begegnungen und Diskussionen.
Wie übernehmen wir, unabhängig von unserer persönlichen Vorliebe und Prägung, Verantwortung für die, die zu unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen kommen? Welche Entwicklungen fördern wir, welche sollten wir kritisch begleiten? Geht es nach jahrhundertelanger „Choral-/Kirchenmusik“-Monokultur jetzt etwa direkt in die nächste Monokultur „Lobpreis und Anbetung“? Ist das die Zukunftsmusik?
Wie findet unsere Kirche – und noch viel wichtiger: wie finden die einzelnen Gemeinden, Ehrenamtliche wie Hauptamtliche – vor Ort ein möglichst produktives und reflektiertes Verhältnis zum neuen Platzhirsch?
Team
Mit der Broschüre „Zukunftsmusik?“ geben wir vielen Ansichten zu diesen Fragen Raum. Es ist wichtig, dass dieses Thema von verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird. So ist eine Sammlung von unterschiedlichen Texten entstanden mit dem Wunsch und Ziel, eine echte Hilfe für die Praxis zu bieten. Denn, so denken wir: Es geht nicht nur um einen Musikstil, nicht nur um die Frage, welche Lieder wir singen. Es geht darum, wie wir einen zentralen Aspekt unseres Glaubens mit Leben füllen.
Vier Personen mit vier verschiedenen Perspektiven sind für diese Broschüre verantwortlich:
Meine Perspektive:
Die Entwicklungen der letzten 20 Jahre im Bereich „Lobpreis und Anbetung“ habe ich mit Freude, Interesse und doch auch mit zunehmender Sorge verfolgt. Zwischen den Jahren 2000 und 2010 wurde ich häufig für Seminare zu diesem Thema angefragt. 2008 bot ich beim CHRISTIVAL ein Seminar mit dem Titel „Anbetung als Lebensstil“ an. Dass dieses Seminar letztlich mit 400 Teilnehmenden stattfinden würde, hätte ich nicht erwartet. Jedoch ist in den letzten Jahren das Interesse an Seminaren für den Bereich „Lobpreis und Anbetung“ sehr stark zurückgegangen. Häufig buchen Gemeinden jetzt einen Musikteamcoach, damit die Lobpreisband noch besser spielt, was ich auch sehr begrüße! Was „Worship“ ist, wissen scheinbar alle schon. Meine große Sorge und Beobachtung ist, dass häufig die Form übernommen, jedoch die Inhalte, die Theologie nicht mitgenommen wurde und damit der Sinn von Anbetung und Lobpreis immer mehr in Vergessenheit gerät bzw. neu definiert wird. Umso wichtiger war mir die Erstellung dieser Broschüre. Mein Wunsch ist, dass dadurch die inhaltliche und geistlich-theologische Auseinandersetzung mit diesem Thema intensiviert wird und das Verständnis neu wächst. Weil die Anbetung – in welcher Form auch immer – Herzstück unseres Glaubens ist und bleibt.
Meine Perspektive:
Musik in Gottesdienst und Gemeinde, „Musik zu Gottes Ehre“ – das ist im Idealfall etwas sehr Verbindendes und Bereicherndes. Umso schmerzlicher empfinde ich es, wenn ich gerade in diesem kreativen, sensiblen und emotionalen Bereich immer wieder Situationen erlebe, die von Abgrenzung, Missverständnissen und gar Antipathie geprägt sind. Die Faustregel „Essen verbindet, Musik trennt“ bewahrheitet sich leider zu oft, weil zwischen den verschiedenen Ausdrucksformen von geistlicher Musik manchmal eben doch (gefühlte) Welten liegen. Deshalb ist es so wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben, einander zuzuhören und voneinander zu lernen. Nur so können unnötige Missverständnisse vermieden werden. Und es kann sich ein fruchtbarer und inspirierender Austausch entwickeln, der eine segensreiche Ausstrahlung haben wird auf unser Musizieren. An dieser Broschüre gefällt mir gut, dass sie ein echter Beitrag sein kann zum gegenseitigen Verständnis und Gelegenheit bieten wird, bei manchen Themen etwas tiefer zu blicken und ins Gespräch zu kommen.
Meine Perspektive:
Meine erste Begegnung mit Lobpreis hatte ich als Jugendlicher beim Kirchentag 1999 in Stuttgart. Der Besuch einer „PraiseNight“ hatte zur Folge, dass wir mit unserer Jugendband ab sofort nicht nur die eigenen Vortrags- Songs spielten, sondern auch Lobpreisabende gestalteten. Über die Jahre kamen unterschiedliche Lobpreis-Erfahrungen in Gemeinden und Netzwerken dazu. Lobpreis und Anbetung sind in meinem Leben quasi schon immer präsent – das Normale. Trotzdem bleibt die Anbetung Gottes weiter bedeutsam und faszinierend für mich: es kommt mir oft so vor, als ob ich erst einen ganz kleinen Teil von der Größe Gottes verstanden und erfahren habe und ich sehne mich danach, durch den Heiligen Geist tiefer in diese Gottesbeziehung hineinzukommen. In unserer Evang. Kirchengemeinde bin ich verantwortlich für den Lobpreis- Gottesdienst am Sonntagmorgen. Da braucht es natürlich die kritische Auseinandersetzung und einen theologisch sorgfältigen Umgang mit diesem Thema. Ich erlebe aber auch oft eine Distanz, die stärker biografisch als theologisch begründet ist und wünsche mir mehr Offenheit für diese Ausdrucksform des Glaubens, denn sie führt letztlich wieder zum Zentralen: der Gegenwart und Begegnung Gottes.
Meine Perspektive:
Als Verantwortlicher im Projekt „Musikteamcoaching“ merke ich: es hat sich viel getan an der Basis. Mehr als ein Drittel aller landeskirchlichen Gemeinden in Württemberg hat Lobpreis- oder Singteams, die mit neuen Liedern (oder liebevollen neuen Arrangements alter Lieder) das gottesdienstliche Singen begleiten und anleiten. Aber ich merke auch: da wird landauf-landab oftmals mehr kOpiert als kApiert. „Wir wollen klingen wie Hillsong!“, aber anderseits ein mehr oder weniger bewusstes: „Bitte erschüttert uns nicht in unserer Kultur. Wir wollen eigentlich gar nicht reflektieren, unsere eigene musikalische Sprache entwickeln.“ Als Gemeindepfarrer in einer umtriebigen, pietistisch-frommen Kirchengemeinde am Rande der Schwäbischen Alb merke ich: es gibt eine Sehnsucht nach persönlicher Gottesbegegnung durch und in der gottesdienstlichen Musik – nicht nur reden über Gott, sondern reden mit ihm. Viel mehr das „per Du mit Gott“, also Beziehungspflege, statt theologischer Richtigkeiten und deskriptiver Liedtexte werden da gefordert. Aber warum immer nur in Antithesen denken? Was uns in Fragen der Frömmigkeitsstile oft nicht gut bekommt, hilft uns auch für die ZUKUNFTSMUSIK nicht wirklich weiter. Wir brauchen eine neue Generation von Brückenbauerinnen ohne Berührungsängste, Anwälte eines neuen Miteinanders. Fitte und verbindende Kräfte an Tasten und Saiten vor Ort und in den Ausbildungsstätten sowie angstfreie Kirchenleitenden, die sie unterstützen und fördern.
